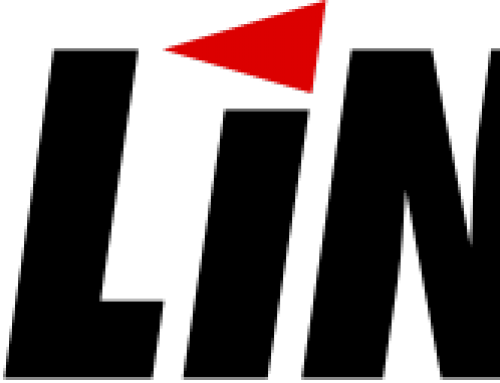Der Antisemitismus war nie weg
In der Bundeshauptstadt neigte sich das Jahr dem Ende zu, nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Das jüdische Lichterfest Hanukkah war bereits im Gange. Nicht nur Weihnachtsbäume, auch ein paar Hanukkah-Leuchter schmückten die Stadt. Gemeinsam diese zu Zeit begehen, als Christen und Juden, so war es geplant. Es hätte ein friedliches Fest werden können. Und doch trübten Bilder des Hasses diese versöhnliche Zeit.
Um einen der Hanukkias haben sich ein knappes Dutzend Polizisten in Kampfuniform aufgestellt. Sie wirken angespannt, die ganze Lage ist angespannt.
Das Foto der Beamten, die das jüdische Symbol vor wütenden Demonstranten beschützen müssen, wird tausendfach in den sozialen Medien geteilt. Es versinnbildlicht die Lage in dieser Stadt, die Lage in diesem Land. Wieder einmal richtet sich der Hass auf den Staat Israel auch auf gegen jüdisches Leben in Deutschland. Erst wenige Tage zuvor brannte am Brandenburger Tor eine Israelfahne – es sollte nicht die letzte sein in diesen Wochen. Die Schuldigen scheinen schnell ausgemacht: Zugewanderte aus den arabischen Staaten, Flüchtlinge, Muslime sollen es sein. Der Blick verengt sich. Antisemitismus, ein importiertes Problem, möchte man meinen.
Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Der Antisemitismus hierzulande war nie weg, so gerne es die Deutschen auch hätten. Sie haben das einzigartige Kunststück vollbracht, die Erinnerungskultur als Volkssport zu kultivieren und sie als Beweis ihrer Wiedergutwerdung wie eine Monstranz vor sich herzutragen. Die Erinnerungskultur erwuchs zum Selbstzweck, am Problem aber ging sie vorbei. Der Antisemitismus in Deutschland erfreut sich nach wie vor bester Gesundheit. So mag es einen Judenhass der Anderen geben, in Deutschland jedoch fällt er auf fruchtbaren Boden.
Volkskrankheiten: Diabetes, Kartoffelsuppe, Israelkritik
Befragungen wie die Mitte-Studien der Universität Leipzig offenbaren, dass bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein antisemitische Stereotype und Vorurteile fest verankert sind. Häufig sind sie getarnt als vermeintliche “Israelkritik”. Das Wort steht sogar im Duden. “Türkeikritik”, “Chinakritik” oder “Russlandkritik” hingegen sucht man dort vergebens.
Das mag Zufall sein und doch zeigt es, wie auch hierzulande mit zweierlei Maß gemessen wird. Wie einzig die Existenz eines jüdischen Staates die Gemüter zum Kochen bringt, während zugleich Völkerrechtsvergehen anderer Länder kaum eine Randnotiz wert sind. Handlungen der israelischen Regierung werden schnell zum Beweis der angeblichen Verkommenheit der Juden. Wenn die Opfer von einst zu den Tätern der Jetztzeit hochstilisiert werden, kommt das gelegen, lenkt es doch so schön ab von der historischen Schuld der Väter und damit auch von der eigenen historischen Verantwortung. So ist es nur konsequent, dass der Hass der Israelkritiker nicht Halt macht vor den Juden hierzulande.
Der jüdische Staat als Schutzraum
Die Existenz des jüdischen Staates aber ist notwendige Konsequenz von Jahrhunderten des Antisemitismus, gipfelnd in der Shoah. Er kann nicht losgelöst von den Verbrechen der europäischen Gesellschaften, allen voran der deutschen, betrachtet werden. Gegründet nicht auf Nationalismus, sondern auf der Erfahrung von Verfolgung, Vertreibung und der industriellen Vernichtung von Millionen Menschen ist dieser Staat Schutzraum und einziger Garant dafür, dass sich all das niemals wiederholen möge. Nicht ohne Grund ist die Sicherheit des Staates Israel Staatsräson der Bundesrepublik.
Die Lehre aus der Shoah heißt Verantwortung, Verantwortung gegenüber der Geschichte, genauso aber der Jetztzeit, Verantwortung gegenüber den toten wie den lebenden Juden. So dürfen wir nicht wegschauen, wenn der Antisemitismus sich auch hierzulande wieder Bahn bricht, wütende Demonstranten “Tod den Juden” skandieren oder rechte Rattenfänger wie Björn Höcke das Berliner Holocaustmahnmal als “Denkmal der Schande” betiteln und den Blick abwenden wollen von den Verbrechen im Dritten Reich. Vor allem aber dürfen wir nicht weghören, wenn Juden von ihren Erfahrungen und Ängsten berichten. Es darf uns nicht kalt lassen, dass sich auch heute wieder Juden in Europa dazu genötigt fühlen, nach Israel zu emigrieren.
Bildung als Schlüssel
Der Antisemitismus muss als Vernichtungsideologie begriffen werden, dem nicht im einfachen Diskurs begegnet werden kann. Zeichnet sich Ideologie doch aus durch die Abwehr von Argumenten, Fakten und Vernunft. Wir müssen Antisemitismus nicht nur auf dem Papier, sondern jeden Tag aufs Neue und überall ächten.
Zugleich müssen wir den Mut haben, auch uns selbst kritisch zu reflektieren. Es bedarf eines tiefgehenden Verständnisses dieser Ideologie sowie ihrer Folgen. Es muss erfahrbar werden, welche Gräuel sie anrichtet und wie sie auch heute noch tief in uns verwurzelt ist, sei es auch noch so subtil und sei es auch noch so schmerzhaft dies anzuerkennen. Dafür braucht es eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte, der Gegenwart und mit uns selbst. Je früher wir damit anfangen, desto größer die Aussicht auf Erfolg.
Die Verankerung eines verpflichtenden Besuchs von Konzentrations- oder Vernichtungslagern in den Lehrplänen aller Schularten ist ein längst überfälliges Mindestmaß dessen. Aber auch die Geschichte Israels muss vertieft behandelt werden, um Antisemitismus vorzubeugen und Verständnis für die weiterhin bestehende Notwendigkeit eines jüdischen Staates zu schaffen.
Diese Auseinandersetzung muss jeder geführt haben, der in Deutschland lebt, ganz gleich der Herkunft oder der Religion. Sie ist ein Schlüssel zur gesellschaftlichen Integration. An der wieder aufkeimenden Schlussstrich-Mentalität in diesem Land zeigt sich nur allzu deutlich, dass diese bei weitem nicht nur Zuwanderern fehlt. Der Kampf gegen Antisemitismus ist ein Kampf, der uns alle etwas angeht und der niemals an Aktualität und Wichtigkeit verliert.
Dieser Beitrag ist eine gemeinsame Antwort von Kim C. Zeuner und Marius J. Brey auf den Artikel “Hass in vielen Gewändern” von Jana Wolf, erschienen am 22. Februar 2018 in der Mittelbayerischen Zeitung.